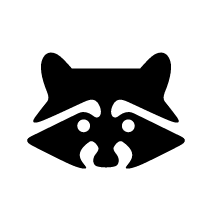Ein Leben mehr
Eine Geschichte, in der es um Menschen geht, die spurlos verschwinden, um einen Todespakt, der dem Leben sein Salz gibt, um den unwiderstehlichen Ruf der Wildnis und um die Liebe, die dem Leben seinen Sinn gibt. Die Geschichte klingt unwahrscheinlich, aber da wir Zeugen haben, muss sie wahr sein. Wer an ihr zweifelt, dem entgeht einer dieser besonderen Orte, wo besondere Menschen leben. Dies ist die Geschichte von drei alten Männern, die sich in den Wald zurückgezogen haben. Drei Männern, die die Freiheit lieben. »Man ist frei, wenn man sich aussuchen kann, wie man lebt.« »Und wie man stirbt.« Das werden Tom und Charlie zu der Besucherin sagen. Zusammen sind sie fast zweihundert Jahre alt. Tom ist sechsundachtzig, Charlie drei Jahre älter, und sie haben noch viele Jahre vor sich, davon sind sie überzeugt. Der Dritte im Bunde schweigt. Er ist vor wenigen Tagen gestorben. Tot und begraben, wird Charlie zu der Besucherin sagen, die ihm zunächst nicht glauben will, weil sie einen langen Weg zurückgelegt hat, um diesen Ted oder Ed oder Edward Boychuck ausfindig zu machen. Die verschiedenen Vornamen und sein ungewisses Schicksal ziehen sich wie ein roter Faden durch die Geschichte. Die Besucherin ist Fotografin und hat noch keinen Namen. Und die Liebe? Nun, die Liebe wird noch etwas warten müssen.
Die Fotografin
Kilometer um Kilometer fuhr ich einen unbefestigten Weg entlang, während sich über mir Gewitterwolken zusammenballten. Die ganze Zeit fragte ich mich, ob sich der Wald wohl lichten würde, bevor es dunkel wurde, oder wenigstens, bevor das Unwetter losbrach. Seit dem frühen Nachmittag fuhr ich über federnde Waldwege, kreuzte hin und wieder einen Forstweg oder eine Quadpiste, und irgendwann kamen nur noch Pfützen, Moosteppiche und Fichten, die immer dichter wuchsen, eine finstere, schwarze Festung. Der Wald würde mich verschlingen, bevor es mir gelang, diesen Ted oder Ed oder Edward Boychuck ausfindig zu machen. Der Vorname änderte sich, aber der Nachname blieb gleich, also musste an den Geschichten etwas dran sein, die man mir über Boychuck erzählt hatte, einen der letzten Überlebenden der Großen Brände.
Ich hatte geglaubt, dass die Wegbeschreibung ausreichen würde: Du fährst immer am Fluss entlang, dann biegst du rechts ab und fährst ungefähr fünfzehn Kilometer bis zum Perfection Lake, der ist leicht zu erkennen, er besteht aus Eiszeitwasser, türkisem Gletscherwasser, der See ist rund wie ein Teller, daher auch der Name, an dem türkisen Teller biegst du links ab, du fährst an einem verrosteten Förderturm vorbei, dann geht es zehn Kilometer immer geradeaus, auf keinen Fall darfst du in einen der alten Forstwege abbiegen, und ab da kannst du dich nicht mehr verfahren, da ist nur noch dieser eine Weg, der ins Nichts führt. Rechts siehst du einen Bach, der durch Felsbecken fließt, und in der Nähe des Bachs steht Boychucks Hütte, aber ich sag’s dir gleich, er bekommt nicht gern Besuch.
Der Fluss, der türkise See, der alte Förderturm, ich folgte der Beschreibung genau, aber ich stieß auf keinen Bach, der durch Felsbecken floss, und auch auf keine Hütte. Plötzlich war der Weg zu Ende. Weiter ging es nur auf einem verwilderten Pfad, für den man ein Quad gebraucht hätte. Mit meinem Pick-up kam ich da nicht durch. Ich überlegte gerade, ob ich umkehren oder auf der Ladefläche übernachten sollte, als ich ganz in der Nähe Rauch sah, ein dünnes Band, das sich über den Baumwipfeln kräuselte. Eine Einladung.
Charlies Blick traf mich, sobald ich die Lichtung betrat, auf der mehrere Hütten standen. Eine Warnung: Niemand betritt sein Reich ohne Einladung.
Sein Hund hatte mich natürlich längst angekündigt, und Charlie erwartete mich vor einer der Hütten. Es musste die Wohnhütte sein, denn aus dem Ofenrohr stieg der Rauch auf, den ich gesehen hatte. Charlie trug mehrere Holzscheite im Arm, er wollte wohl gerade das Abendessen kochen. Während unseres gesamten Gesprächs hielt er die Scheite umklammert und stand reglos vor der geschlossenen Fliegengittertür. Er machte keine Anstalten, mich hineinzubitten. Die eigentliche Tür stand offen, damit die Hitze des Ofens entweichen konnte. Drinnen war es dunkel und ich konnte nicht viel erkennen, nur ein schemenhaftes Durcheinander, aber der Geruch war mir vertraut. Es war der Geruch von Waldmenschen, der Mief von Männern, die seit Jahren keiner Dusche oder Badewanne nahe gekommen waren. Denn so etwas besaßen meine alten Freunde nicht. In ihren Hütten roch es nach ungewaschenen Körpern und ranzigem Fett, weil sie sich hauptsächlich von Wild ernährten, gebraten oder als Eintopf, ein Fleisch, dem man viel Fett beigeben muss, es roch nach dem Staub, der in dicken Schichten auf allem lag, was nicht regelmäßig bewegt wurde, und es roch nach trockenem Tabak. Der Tabak war ihre Lieblingsdroge. Die Anti-Raucher-Kampagnen der Regierung waren nicht bis zu ihnen vorgedrungen, und so kauten einige meiner alten Freunde nach wie vor auf ihrem Nikotinklumpen herum oder schnupften andächtig ihren Copenhagen. Man kann sich gar nicht vorstellen, wie wichtig der Tabak ihnen war.
Charlies Zigarette wanderte zwischen seinen Mundwinkeln hin und her wie ein kleines zahmes Tier, und als sie erlosch, blieb sie einfach dort hängen. Charlie hatte immer noch kein Wort gesagt. Zuerst dachte ich, er wäre der Mann, den ich suchte, dieser Ed oder Ted oder Edward Boychuck, der die Großen Brände überlebt hatte und der vor seinem eigenen Leben in den Wald geflohen war. In dem Hotel, wo ich übernachtet hatte, bekam man ihn nur selten zu Gesicht. Das Hotel war eine Absurdität, ein dreistöckiges Gebäude mitten im Nichts, einst eine Nobelherberge und mittlerweile nur noch eine traurige Ruine. Der Mann, den ich für den Besitzer gehalten hatte, der aber nur Pächter war – du kannst Steve zu mir sagen, meinte er gleich zu Beginn unseres Gesprächs –, erzählte, das Hotel sei von einem reichen Spinner erbaut worden, einem Libanesen, der mit dem Verkauf von gepanschtem Schnaps viel Geld gemacht und mit größenwahnsinnigen Bauprojekten alles wieder verloren hatte. Er hatte geglaubt, die Gegend wäre das neue Klondike und bald würde eine Eisenbahnlinie dort hochführen, und er wollte der Erste sein, der an der neuen Kundschaft verdiente. Das war seine letzte verrückte Idee, sagte Steve. Das mit dem Klondike war natürlich Unsinn, keine Eisenbahnlinie führte jemals zu dem Hotel des Libanesen, der Spinner zog in die Vereinigten Staaten und eröffnete eine Hotelkette für Lkw-Fahrer.
Ich mag solche Orte, die jeden Anspruch und jede Koketterie aufgegeben haben, Orte, die sich an eine fixe Idee klammern und darauf warten, dass die Zeit ihnen recht gibt. Das schnelle Geld, die Eisenbahn, die Rückkehr der alten Freunde, niemand weiß genau, worauf sie eigentlich warten. In der Gegend gab es mehrere solcher Orte. Sie trotzten ihrem eigenen Verfall und arrangierten sich mit der Einsamkeit.
Steve, der Hotelpächter, unterhielt mich den ganzen Abend lang mit Anekdoten über das harte Leben da draußen, aber ich durchschaute ihn. Stolz erzählte er mir von hungrigen, zeckenzerfressenen Bären, die ihm vor der Tür auflauerten, von dem Wind, der nachts am Haus rüttelte, und von den Mücken, ich habe dir ja noch gar nicht von den Mücken erzählt, im Juni ist hier alles voll davon, Stechmücken, Kriebelmücken, Gnitzen, Bremsen, am besten wäscht man sich gar nicht mehr, denn es gibt nichts Besseres als eine ordentliche Schmutzschicht, um sich vor den Mistviechern zu schützen, und dann die Januarkälte! Ah, die Januarkälte, darauf sind die Leute im Norden besonders stolz. Steve beschwerte sich ausgiebig über die strengen Winter, damit ich bewunderte, wie abgehärtet er war.
»Und Boychuck?«
»Boychuck ist eine offene Wunde.«
Der Alte, der reglos und stumm vor seiner Hütte stand, konnte nicht der Mann sein, den ich suchte. Er strahlte eine zu große Ruhe und Gelassenheit aus. Fast schon gutmütig wirkte er, obwohl er mich argwöhnisch musterte, als wollte er herausfinden, was ich zu verbergen hatte. Animalisch war das Wort, das mir spontan zu ihm einfiel. Er hatte einen animalischen Blick. Sein Blick war nicht aggressiv, Charlie war kein Raubtier, aber er war wachsam, auf der Hut, er schien sich immer zu fragen, was eine Bewegung im Unterholz, ein aufblitzendes Licht, ein allzu breites Lächeln oder allzu schöne Worte zu bedeuten hatten. Und obwohl ich mir große Mühe gab, hatten meine Worte ihn nicht davon überzeugt, dass es eine gute Idee war, mir die Tür zu öffnen.
Wenn man Menschen, die fast ein Jahrhundert auf dem Buckel haben, einen Besuch abstattet, schüttelt man nicht einfach irgendeine Geschichte aus dem Ärmel. Man braucht Fingerspitzengefühl, Geschick, aber man darf es nicht übertreiben, denn alte Leute durchschauen dich schnell, in den letzten Jahren ihres Lebens bleibt ihnen schließlich nicht viel anderes als Gespräche, und sorgfältig zurechtgelegte Sätze machen sie misstrauisch.
Als Erstes sagte ich ein paar Worte zu seinem Hund, einer Mischung aus Neufundländer und Labrador, der aufgehört hatte zu bellen, mich aber nicht aus den Augen ließ. Du bist aber ein schönes Tier, sagte ich, und das Kompliment galt dem Herrchen ebenso wie dem Hund. Ein Labrador? Ich erntete ein knappes Nicken und einen abwartenden Blick. Ich hatte den weiten Weg doch wohl nicht zurückgelegt, um mit ihm über seinen Hund zu reden?
Ich bin Fotografin, sagte ich schnell, um kein Missverständnis aufkommen zu lassen. Ich wollte ihm nichts verkaufen, ihm keine schlechte Nachricht überbringen, ich war keine Sozialarbeiterin oder Krankenschwester, und ich war auch nicht von irgendeinem Amt, denn das waren die Schlimmsten, das wusste ich von den vielen alten Menschen, die ich besucht hatte. Sie sind doch hoffentlich nicht von der Regierung? Die Frage kommt unweigerlich, wenn ich meine Anwesenheit nicht schnell genug erkläre. Die Alten können niemanden von der Regierung gebrauchen, der ihnen sagt, dass es da ein Problem gibt, hier, in den Unterlagen, in den Briefen, in den Papieren, die Zahlen stimmen nicht überein, mit Ihrer Akte stimmt etwas nicht. Und weil etwas mit meiner Akte nicht stimmt, stimmt auch mit mir etwas nicht? Elendes Regierungspack. Raus, da ist die Tür! Ich bin Fotografin, wiederholte ich, ich fotografiere die Überlebenden der Großen Brände.
Boychuck hatte seine ganze Familie in dem Großen Brand von Matheson im Jahr 1916 verloren, und diese Tragödie trug er sein Leben lang mit sich herum.
Der Mann, der mir gegenüberstand, war hingegen unversehrt, er war solide, ihm konnte nichts etwas anhaben. Sein Blick wanderte zum Himmel und sein Gesicht verdüsterte sich angesichts der regenschwangeren Wolken direkt über uns. Als Charlie mich wieder ansah, lag in seinem Blick der Blitz des Gewitters, das jeden Moment losbrechen konnte. Wie ein Tier, dachte ich, er reagiert nur auf die Natur.
Ich erklärte ihm, warum ich gekommen war, und nannte ihm vorsichtshalber alle Namen. Ich hatte einen getroffen, der einen anderen kannte, der mir von einem Dritten erzählt hatte. Ich erläuterte, wie ich mich von einer Bekanntschaft zur nächsten gehangelt hatte, wie jeder der alten Leute mir als Passierschein gedient hatte und wie ich schließlich hier gelandet war, auf diesem wunderschönen Fleckchen Erde, ich verstehe gut, dass Sie hergezogen sind, Mister Boychuck, mit diesem herrlichen See direkt vor der Tür und der ganzen Natur ringsherum, und wenn Sie ein paar Minuten Zeit hätten, würde ich mich gern in Ruhe mit Ihnen unterhalten.
Das war ein billiger Trick, ich wusste genau, dass er nicht Boychuck war, aber manchmal darf man es mit der Wahrheit nicht so genau nehmen.
Boychucks Name erschütterte ihn mehr, als er zeigen wollte. Er blinzelte, und in diesem Moment wurde der Himmel schwarz, die Erde ging unter und der Donner grollte ungeduldig. Endlich machte Charlie den Mund auf:
»Boychuck ist tot und begraben.«
Mehr würde er nicht sagen, das Gespräch war beendet. Er wollte mir gerade seinen breiten Bärenrücken kehren, als der Himmel die Schleusen öffnete. Der Regen ging auf uns nieder, als stünden wir unter der Dusche. Charlie öffnete die Fliegentür und schob mich in die Hütte. Es lag eine natürliche Autorität in seiner Berührung. Ich spürte sie kaum, seine Hand auf meinem Rücken war leicht und trotzdem resolut.
»Komm rein, sonst wirst du nass.«
Seine Stimme war genauso abweisend wie sein Verhalten. Er ging zum Herd, einem kleinen Holzofen – so einen winzigen hatte ich noch nie gesehen –, und schaute nach dem Feuer, ohne mich weiter zu beachten. Das Feuer war erloschen. Er schichtete Kleinholz übereinander, blies in die Glut, warf ein paar Rindenstücke hinein, blies noch einmal, und als die Flammen aufflackerten, verschloss er die Herdklappe und die Luftschlitze und trat an die Arbeitsfläche, die ich im Halbdunkel nur vage erkennen konnte. Er begann Kartoffeln zu schälen, und aus der Menge schloss ich, dass ich zum Abendessen eingeladen war.
Der Regen trommelte aufs Dach, er war noch stärker geworden, zwischendurch verstand man sein eigenes Wort nicht. Der Wind heulte um die Hütte, und es donnerte und blitzte. Wir beide wussten, dass ich nicht zu meinem Pick-up zurückkonnte.
»Du wirst hier übernachten müssen.«
Ich schlief auf einem Lager aus Pelzen wie eine Prinzessin in einem alten Märchen, auf einer weichen Bettstatt aus den Fellen eines Schwarzbären, eines Silberfuchses, eines Wolfs und eines Marders, dessen dunkelbraunes Fell fast schwarz schimmerte. Charlie war beeindruckt, dass ich sie alle kannte. Vor allem der Marder ist ein sehr seltenes Tier, und sein Fell ist noch seltener, denn er ist schlau und aggressiv und geht einem nicht so leicht in die Falle. Aber die Fallenstellerei lohnt sich eh nicht mehr, erklärte Charlie, heutzutage bekommt man fast nichts mehr für die Pelze. Ich beeindruckte ihn an dem Abend noch öfter. Zum Beispiel, wenn ich den Namen eines Gewächses wusste, über das wir sprachen, eines Farns, einer Flechte oder eines Strauchs, während er, der den Wald in- und auswendig kannte, keine Ahnung hatte, wie es hieß. Er konnte eine Pflanze, die im Unterholz wuchs, so präzise wie ein Botaniker beschreiben, ihre Umgebung, ihre Lebensgewohnheiten, die Art und Weise, wie sie den Tau einfing, um sich vor der Trockenheit und den heißen Sommerwinden zu schützen. All das wusste er, aber den Namen der Pflanze kannte er nicht. Maianthemum canadense, sagte ich. Er fragte, ob die Beeren wirklich giftig seien. Er nannte die Maianthemun canadense Rebhuhngift. Die Beeren sind genießbar, erklärte ich, aber wenn man zu viele davon isst, bekommt man Durchfall.
»Woher weißt du das alles?«
Ich bin keine Botanikerin, Biologin oder so was in der Art, aber ich kenne mich aus, weil ich zwanzig Jahre mit solchen Leuten durch die Wildnis gestreift bin. Die Natur war mein Spezialgebiet. Ich nannte mich Waldfotografin. Jahrelang beugte ich mich über Blätter und Blüten und führte ein geruhsames Leben, aber irgendwann hatte ich die Nase voll. Ich sehnte mich nach Menschen, nach Gesichtern, Händen und Blicken, ich hatte keine Lust mehr, über Stunden hinweg eine Spinne zu beobachten, die ihrer Beute auflauert. Durch einen Zufall stieß ich auf die Großen Brände und die Menschen, die sie überlebt hatten. Mittlerweile sind die Zeitzeugen natürlich sehr alt. Der erste Große Brand wütete im Jahr 1911. An dieser Stelle geriet das Gespräch ins Stocken. Charlie verstummte, sobald ich auf das Thema zu sprechen kam.
Trotzdem war es ein schöner Abend. Charlie freute sich über die Gesellschaft, das merkte man, sein Gesicht hatte sich entspannt, aber hören konnte ich es nicht, seine tiefe Stimme klang immer noch genauso brummig wie bei meiner Ankunft.
Wir erzählten uns unser Leben, ich erzählte von meinem Leben unterwegs, immer auf der Suche nach einem neuen Gesicht, einer neuen Begegnung, und er von seinem Leben in der Wildnis, wo er der Zeit beim Vergehen zusah und nichts anderes zu tun hatte, als zu leben. Aber damit hat man genug zu tun, sagte er, und das glaubte ich gern, denn es musste harte Arbeit sein, hier draußen im Wald nicht zu verhungern oder zu erfrieren, so ganz allein. Ich betonte das Wort »allein«, aber er durchschaute mich. Er war ein geübter Fallensteller, er witterte die Gefahr, er ließ sich nicht mit einem so billigen Trick hereinlegen.
»Ich hab ja meinen Chummy«, sagte er, und sein Blick ging zu dem Tier. Der Hund hatte die ganze Zeit neben der Tür gelegen und geschlafen, aber sein Schlaf war unruhig. Bei jedem Donnerschlag zuckte er zusammen und sein Fell sträubte sich vom Kopf bis zum Schwanz. Dann atmete er wieder tief und gleichmäßig, bis zum nächsten Donnergrollen.
Als Charlie seinen Namen sagte, sprang er auf und legte sich seinem Herrn vor die Füße.
»Nicht wahr, Chummy, wir beiden sind ein gutes Team. Sag unserer Besucherin, dass wir ein gutes Team sind.«
Charlie strich ihm übers Fell, widmete sich ausführlich dem Hals, stieß hinter den Ohren auf verfilztes Haar, zupfte es in kleinen Büscheln aus, fuhr dem Tier über den Rücken, sanft und trotzdem kräftig, streichelte und kraulte ihn mit gekonnter Hand, und der Hund brummte zufrieden, während sein Herrchen sich mit der Besucherin unterhielt und immer mal wieder ein Wort an ihn richtete.
»Wir zwei beiden haben es gut miteinander, was, Chummy?«
Ich war beeindruckt von dieser dicken, knotigen Hand mit den steifen Gelenken, die im Fell des Hundes so geschmeidig war, und mehr noch von Charlies Stimme, die, wenn sie dem Hund galt, leiser wurde, samtweich und zärtlich. Mit derselben weichen Bassstimme erklärte mir Charlie, dass sein Chummy Angst vor Gewittern habe.
»Er fürchtet sich vor dem Donner«, sagte er, »deshalb hole ich ihn bei Gewitter zu mir rein.«
Dann verschwand die Violoncellostimme, und Charlie sprach wieder im Tonfall des Herrn über die Wälder. Später, als er das Bündel Pelze aufschnürte, um mir ein Schlaflager zu bereiten, waren die geschmeidige Hand und die Samtstimme wieder da.