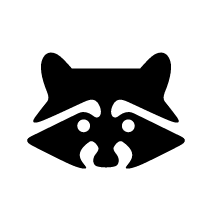Das Sommerbuch
DER GEISTERWALD
Hinter dem Felsen, zum offenen Meer hin, erstreckte sich ein Waldgürtel mit abgestorbenen Bäumen, der ständig dem Wind ausgesetzt war. Seit vielen hundert Jahren versuchte der Wald, gegen die Stürme anzuwachsen, dadurch hatte er ein ganz eigenes Gesicht erhalten. Im Vorbeirudern sah man deutlich, dass die Bäume sich vom Wind wegstreckten, sie duckten und verknoteten sich, ja, viele von ihnen krochen geradezu. Nach und nach brachen die Stämme, oder sie vermoderten und versanken, das abgestorbene Holz stützte oder erdrückte jenes, das noch grüne Spitzen hatte, und alles zusammen bildete eine verfilzte Masse aus hartnäckiger Ergebenheit.
Der Boden glänzte von braunen Nadeln, bis auf die Stellen, wo die Tannen beschlossen hatten zu kriechen, anstatt zu stehen, dort wucherte ihr Grün in einer Art üppiger Raserei, feucht und leuchtend wie in einem Urwald. Der Wald wurde Geisterwald genannt. Er hatte sich selbst langsam und mühselig geformt, und das Gleichgewicht zwischen Überleben und Sterben war so empfindlich, dass nicht einmal die geringste Veränderung vorstellbar war. Eine Lichtung zu schlagen oder die zusammengesunkenen Stämme zu trennen hätte zum Untergang des Geisterwaldes führen können. Das sumpfige Wasser durfte nicht abgeleitet, hinter der dichten, schützenden Mauer nichts gepflanzt werden.
Tief im Gestrüpp, in den stets dunklen Höhlen, hausten Vögel und Kleingetier, bei ruhigem Wetter konnte man Flügelrascheln oder hastig rennende Pfoten hören. Die Tiere selbst zeigten sich nie.
Zu Beginn ihrer Zeit auf der Insel versuchte die Familie den Geisterwald noch unheimlicher zu machen, als er ohnehin schon war. Auf den umliegenden Inseln sammelten sie Baumstümpfe und dürre Wacholderbüsche und ruderten sie herüber, gewaltige Exemplare verwitterter und verblichener Schönheit wurden über die Insel geschleppt, dabei zerbrachen und zersplitterten sie und hinterließen breite, leere Wege bis zu dem Platz, wo sie stehen sollten.
Die Großmutter sah, dass dies alles nicht gut war, sagte aber nichts. Hinterher säuberte sie nur das Boot und wartete, bis der Geisterwald ihnen langweilig geworden war. Da begab sie sich allein in ihn hinein. Langsam kroch sie an dem Tümpel und den Farnbüschen vorbei, und wenn sie müde wurde, legte sie sich auf den Boden und sah durch das Netzwerk aus grauen Flechten und Zweigen hinauf. Die anderen fragten, wo sie denn gewesen sei, und sie antwortete, sie habe vielleicht ein Stündchen geschlafen.
Hinter dem Geisterwald wurde die Insel zu einem schönen, ordentlichen Park. Jeder noch so kleine Zweig wurde, während die Erde von Frühlingsregen durchtränkt dalag, von der Familie weggeräumt. Danach führten nur schmale Pfade vom einen Ende der Insel zum andern und zum Sandstrand hinunter. Nur Bauern und Feriengäste gehen durchs Moos. Sie wissen nicht, dass Moos das Allerempfindlichste ist, was es gibt, das kann man gar nicht oft genug wiederholen. Wenn man einmal aufs Moos tritt, richtet es sich bei Regen wieder auf, beim zweiten Mal bleibt es liegen. Beim dritten Mal ist das Moos tot. Das ist wie bei den Eiderenten; wenn sie zum dritten Mal von ihrem Nest aufgeschreckt werden, kehren sie nie mehr zurück.
Irgendwann im Juli schmückte das Moos sich mit einem leichten, langstieligen Gras. Die Rispen öffneten sich in exakt dem gleichen Abstand vom Boden und schaukelten gemeinsam im Wind, wie auf den Wiesen des Festlandes. Dann überzog ein warmer, kaum sichtbarer Schleier die Insel, der nach einer Woche wieder verschwunden war. Es gab nichts, das so sehr an Unberührtheit und Wildnis erinnerte.
Drinnen im Geisterwald saß die Großmutter und schnitzte fremdartige Tiere. Sie schnitt sie aus Ästen und Holzstücken aus und gab ihnen Pfoten und Gesichter, aber das Aussehen der Tiere blieb immer vage, wurde nie zu deutlich. Sie behielten ihre Seele aus Holz, und in der Krümmung der Rücken und Beine drückte sich die unergründliche Form des Wachstums aus, die immer noch ein Teil des modernden Waldes war. Gelegentlich schnitt die Großmutter sie direkt aus einem Baumstumpf oder einem Stamm aus. Ihre Holztiere wurden immer mehr. Sie saßen festgehakt oder rittlings in den Bäumen, manche lehnten an den Stämmen oder verschwanden halb im Untergrund, mit ausgestreckten Armen versanken sie im Moorwasser oder lagen ruhig zusammengerollt am Fuß einer Wurzel und schliefen. Manchmal bildeten sie nur einen Umriss im tiefen Schatten, dann wieder waren sie zu zweit oder zu dritt in eine Schlägerei oder in eine Liebesumarmung verwickelt. Die Großmutter arbeitete ausschließlich mit altem Holz, das bereits seine Form gefunden hatte, sie sah und wählte also nur die Holzstücke, die genau das ausdrückten, was sie wollte.
Einmal fand die Großmutter einen großen weißen Rückenwirbel im Sand. Der Wirbel ließ sich nicht bearbeiten, dazu war er zu hart, aber er konnte gar nicht schöner werden, deswegen legte sie ihn, so wie er war, in den Geisterwald. Sie fand noch weitere weiße oder grau gewordene Knochen, alle vom Meer an Land gespült.
»Was machst du da eigentlich?«, fragte Sophia.
»Ich spiele«, antwortete die Großmutter.
Sophia kroch in den Geisterwald hinein und sah alles, was ihre Großmutter getan hatte.
»Ist das hier eine Vernissage?«, fragte sie. Aber die Großmutter erklärte, das habe nichts mit Skulptur zu tun, Skulptur sei etwas ganz anderes.
Sie begannen gemeinsam an den Ufern Knochen zu sammeln.
Suchen und Sammeln, das ist was ganz Eigenes, da sieht man nämlich nichts als das, was man sucht. Wenn man Preiselbeeren sammelt, sieht man nur das, was rot ist, und sucht man Knochen, sieht man nur alles Weiße, wo man sich auch bewegt, sieht man nichts außer Knochen – Knochen, die mitunter nadeldünn sind, äußerst zart und zerbrechlich, und die man mit größter Vorsicht tragen muss. Dann wieder sind es riesige, grobe Schenkelknochen oder ein Käfig aus Rippen, die wie die Spanten eines Wracks im Sand begraben liegen. Die Knochen haben tausend Formen, und jeder hat seine eigene Struktur.
Sophia und die Großmutter trugen alles, was sie fanden, in den Geisterwald, den sie immer in der Abenddämmerung aufsuchten. Der Erdboden unter den Bäumen wurde mit einer Zeichensprache aus weißen Arabesken dekoriert, und wenn das Bildmuster fertig war, blieben die Großmutter und Sophia sitzen und unterhielten sich ein wenig und lauschten den Bewegungen der Vögel im Dickicht. Einmal flog ein Auerhahn hoch, und ein andermal sahen sie eine sehr kleine Eule. Die Eule saß auf einem Zweig und zeichnete sich gegen den Abendhimmel ab. Die Insel war bisher noch nie von einer Eule besucht worden.
Eines Morgens fand Sophia den makellosen Schädel eines großen Tieres. Sie fand ihn ganz allein. Die Großmutter nahm an, dass es ein Seehundschädel war. Sie versteckten den Schädel in einem Korb und warteten bis zum Abend. Der Sonnenuntergang bestand aus lauter roten Farben, das Licht ergoss sich über die ganze Insel, sodass selbst der Boden rot wurde. Sie trugen den Schädel in den Geisterwald, und dort lag er nun und leuchtete mit all seinen Zähnen.
Plötzlich begann Sophia zu schreien. »Nimm ihn weg!«, schrie sie. »Nimm ihn weg!« Die Großmutter nahm sie sofort in die Arme, hielt es aber für das Beste, nichts zu sagen. Nach einer Weile schlief Sophia ein.
Die Großmutter überlegte, wie man auf dem Sandstrand ein Haus aus Streichholzschachteln bauen könnte, hinter dem Haus müsste Heidelbeerkraut wachsen. Man könnte einen Steg hinzufügen und Fenster aus Silberpapier machen.
So kam es, dass die Tiere aus Holz in ihrem Wald verschwinden durften. Die Arabesken sanken in den Boden und wurden grün bemoost, und im Lauf der Zeit fielen die Bäume einander immer tiefer in die Arme. Abends, wenn es dämmerte, ging die Großmutter oft allein in den Geisterwald. Aber tagsüber saß sie auf der Verandatreppe und schnitzte Rindenschiffchen.
aus Tove Jansson: DAS SOMMERBUCH